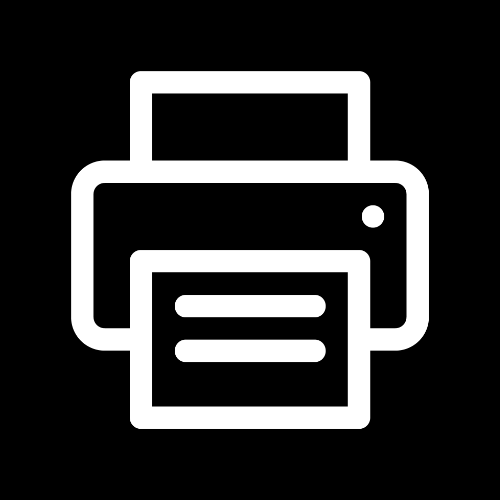Gesellschaftlicher Mehrwert oder Schmarotzertum?
Kunstförderung zwischen Kostensteigerung und Fair Practice
Uwe Friedrich, Veröffentlicht: 31. Juli 2023
(Aktualisiert: 13. August 2023)
In seinem Essay zeigt Uwe Friedrich die Entwicklungen der öffentlichen Kunstförderung in den Niederlanden und Irland im Vergleich zu Deutschland auf. Die Herausforderungen sind gleich, die finanzielle Ausstattung nicht, das gesellschaftliche Klima ist überall von Gleichgültigkeit gegenüber den Künsten geprägt.
Die Darstellenden und die Bildenden Künste haben dasselbe Problem wie die großen Kirchen: Während der gesellschaftliche Konsens über ihre Wichtigkeit bröckelt, ist der Mehrwert ihres Kerngeschäfts schwer zu berechnen, und gleichzeitig ist klar, dass der materielle Aufwand allein durch Eintrittsgelder bzw. den Erlös des Klingelbeutels nicht zu decken ist. Während die Finanzierung der Kirchen in Zeiten großer Abwanderungsbewegungen noch völlig offen ist, übernehmen im deutschsprachigen Raum die staatlichen Körperschaften seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert mehr und mehr die Finanzierung der Kunst.
Was vorher selbstgewählte Aufgabe von prunkliebendem Adel und aufstrebenden Privatleuten war, übernahm nun der Staat. Damit trat er in die Fußstapfen einer reichen Elite und übernahm auch das historische Erbe der Kunstfinanzierung. In der Monarchie war das aufstrebende Bürgertum von direktem politischem Einfluss weitgehend ausgeschlossen und entwickelte zur Selbstvergewisserung jene bürgerliche Hochkultur, die bis heute das Theater- und Musikleben in Deutschland in den Städten prägt.
Diese Kulturszene war sehr lange elitär und exklusiv. Die großen Schauspiel- und Opernhäuser in den Stadtzentren wurden von einer tonangebenden Oberschicht zu Repräsentationszwecken geplant und gebaut, sie kopierten in der Regel höfische Architektur und sollten sowohl den gesellschaftspolitischen Aufstiegswillen als auch die Abgrenzung gegenüber der proletarischen Arbeiterkultur deutlich machen. Das Angebot wandte sich kaum an die weniger vermögenden Schichten, die allenfalls zur moralischen Erhebung und Verbesserung auf den billigen Plätzen geduldet wurden.
Das Unterhaltungsbedürfnis der wachsenden Schicht der Arbeiter und Angestellten wurde vor allem von kommerziellen Theater- und Musikunternehmen abgedeckt, die sich weniger um den moralischen, erzieherischen und erhebenden Anspruch kümmerten. Zumindest zum Teil kommt die strikte Trennung der „ernsten“ und „unterhaltenden“ Kultur im deutschsprachigen Raum aus dieser Zeit.
Im angelsächsischen Raum spielte die Hochkultur kaum eine Rolle zur Repräsentation der herrschenden Elite. Hier baute der Hochadel keine Opernhäuser, sondern große Landsitze, Musik und Theater waren schon immer kommerzielle Unternehmungen oder das ambitionierte Hobby von Laienvereinigungen. Wo sich aber alle darstellenden Künste auf dem Unterhaltungsmarkt behaupten müssen, wird der Unterschied nicht mehr so groß empfunden wie hierzulande.
In den Niederlanden mit ihrer starken religiösen Prägung durch den Calvinismus hat es nach außen gewandte Repräsentationskultur ohnehin schwer. Zwar galt Reichtum als weltliches Zeichen eines gottgefälligen Lebens. Gleichzeitig galt die öffentliche Zurschaustellung des eigenen Erfolgs als unangemessen, Geld wurde für Bildung und Infrastruktur ausgegeben, das öffentliche Kulturleben in den Städten entwickelte sich jedoch erst in der zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts, als auch Bauten wie das Amsterdamer Stadttheater oder das Concertgebouw nach deutschem und französischem Vorbild entstanden. Diese unterschiedlichen historischen Ausgangspunkte zeigen sich bis heute in der Förderpraxis der öffentlichen Hand.
In der Veränderung der Förderkriterien für freie Künstler seit den neunziger Jahren, spätestens aber seit der letzten Finanzkrise zeigen sich jedoch auch erstaunliche Parallelen. Bei den Gesprächen mit verschiedenen Theaterleitern, Geschäftsführern von Kulturinstitutionen, Künstlerinnen und Künstlern in allen drei Ländern zeichnete sich bald ab, dass keiner von ihnen mit Namen zitiert werden wollte. Auch das ist ein Zeichen der Wirksamkeit von finanziellen Drohgebärden der Kultur- und Haushaltspolitiker. Offenbar möchte sich keiner der Abhängigen durch Kritik profilieren und unbeliebt machen. Die Äußerungen der Befragten sind deshalb mittelbar in diesen Essay eingeflossen.
Calvinistische Strenge in den Niederlanden
Der größte Unterschied zwischen Deutschland und den Niederlanden sowie Irland ist, dass es hierzulande bislang keinen massiven finanziellen Einbruch in der Kunstförderung gab. Weder schlug sich die Finanzkrise 2007/2008 in deutlichen Kürzungen nieder, die in Irland ungefähr zu einer Halbierung der Zuwendungen des Arts Councils führte, noch brach eine konservative Regierung bei Amtsantritt mit der Politik der Vorgängerregierungen, wie es unter dem niederländischen Noch-Ministerpräsidenten Mark Rutte seit Mitte des Jahres 2010 geschah. Um 200 Millionen Euro kürzte die Regierung in Den Haag ab 2013 die Ausgaben für die Kultur, das sind etwa 20%.
Dieser scharfe Einschnitt in den Etat von ursprünglich 950 Millionen Euro sorgte für große, auch internationale Proteste, von denen sich die niederländische Regierung aber unbeeindruckt zeigte. Ein gesamtgesellschaftlicher Aufschrei blieb jedoch aus, bei den angekündigten Protestmärschen wollten nur wenige Bürger ihre Künstler unterstützen. Offiziell galt zwar seit dem Zweiten Weltkrieg in den Niederlanden der Konsens, dass der Staat sowohl die Hochkultur fördert, als auch eine reiche Kulturlandschaft in den ländlichen Gebieten finanziell unterstützt. Dieser Konsens konnte jedoch unter dem neuen Kulturstaatssekretär Halbe Zijlstra ohne größeren Widerspruch aufgekündigt werden. Der vorher zuständige Staatssekretär von der Arbeitspartei sorgte jahrelang für steigende Etats bis zum Höchststand von 930 Millionen Euro vor der Wahl im Jahr 2010.
Mit dem Regierungswechsel zum ersten Kabinett Rutte änderte sich jedoch das gesellschaftliche Klima. Der neue Staatssekretär Zijlstra von der VVD äußerte sich in deutlich abwertender Weise über die Empfänger der staatlichen Förderung und vermittelte so den Eindruck, Fördermittelempfänger würden auf Kosten des Staates leben, ohne Leistungs- und Qualitätskriterien erfüllen zu wollen oder zu können. Ministerpräsident Rutte stärkte seinem Staatssekretär den Rücken und sprach sich öffentlich gegen das „graue Mittelmaß“ der Flächenförderung aus. Stattdessen sollten „kulturelle Leuchttürme“ wie das Amsterdamer Concertgebouw Orkest oder das Rijksmuseum bevorzugt gefördert werden.
Von diesem finanziellen Einbruch und dem politisch gewollten Ansehensverlust hat sich die niederländische Kulturszene bis heute allenfalls langsam erholt, die verheerenden Folgen sind noch immer spürbar. Die Zeit des ständigen Wachstums war vorbei. Während es in den 50er Jahren in den Niederlanden nur sieben Symphonieorchester gab, erhöhte sich die Zahl durch stetig steigende staatliche zuwendungen bis in die frühen 2000er Jahre auf 16, die der Theatergruppen von ebenfalls sieben auf zwanzig. Nach den Kürzungen mussten viele von ihnen fusionieren, andere verschwanden ganz.
Trotz der verfassungsrechtlich garantierten Kunstfreiheit griff die Regierung mit ihrem Beharren auf einer nicht weiter definierten „Qualität“ so offensichtlich in die Kulturszene ein, dass der gesamte „Raad voor Cultuur“ zurücktrat, bald gefolgt von der „Kommission für Bühnenkunst“. Beide Gremien sollten die Regierung beraten, aber die Ignoranz des Kabinetts von Mark Rutte wurde allgemein als Affront verstanden und brach mit allen niederländischen Nachkriegsgewohnheiten.
Hauptfolge der durchgesetzten Sparbeschlüsse von 2011 war eine wachsende Selbstausbeutung der Künstler, die nun versuchten, für weniger Geld dasselbe zu leisten. Ein Teil dieser Folgen konnte durch zahlreiche Fonds und Stiftungen abgefedert werden, die seit vielen Jahren neben dem Staat vor allem einzelne Künstler oder Projekte fördern. In den vergangenen zehn Jahren haben jedoch auch der skandalerprobte Mark Rutte, seine Minister und Staatssekretäre feststellen müssen, dass Qualität im Bereich der Kultur nur schwer zu messen ist.
Deshalb wurden unter der ehemaligen Kulturministerin Ingrid van Engelshoven (Amtszeit von 2017 bis 2022) neue Kriterien der Förderwürdigkeit bestimmt. Während früher großer Wert auf die messbaren Zahlen des erreichten Publikums gelegt wurde, soll seitdem die „Wirksamkeit“ der künstlerischen Darbietungen nachgewiesen werden. Das erweist sich aber als mindestens ebenso schwierig. Transparenz in der künstlerischen Entscheidungsfindung nach den Maßstäben des „Good Governance Code“ wird ebenso gefordert wie Fair Practice in den Anstellungsverhältnissen und eine angemessene Bezahlung der Künstlerinnen und Künstler.
Diese neuen Aufgaben müssen jedoch mit denselben öffentlichen Mitteln erbracht werden. Das führt zwar dazu, dass die glücklichen Mitwirkenden einer stattfindenden Produktion besser bezahlt werden, hat aber zur Folge, dass wegen der gleichgebliebenen Gesamtsumme der Fördermittel insgesamt weniger Produktionen stattfinden. Ähnliche Folgen hat die Forderung nach größerer Diversität sowohl unter den Kunstschaffenden als auch im Publikum. In den ohnehin knappen Budgets der Institutionen muss nun auch noch Geld für Outreach-Programme und aufwändige Werbemaßnahmen gefunden werden.
Den Sinn dieser Unternehmungen stellt niemand infrage, aber nur die wenigstens Institutionen haben die Mittel dafür. Dieses Dilemma ist zwar auch im Kulturministerium bekannt, ebenso in den Provinzen zwischen Zeeland, Friesland und Limburg sowie bei den Städten und Kommunen, die jeweils eigene Fördertöpfe unterhalten, mit einer Erhöhung der finanziellen Mittel ist allerdings nicht zu rechnen. Die derzeitige Kulturstaatssekretärin Gunay Uslu hat immerhin angekündigt, dass bis zum Jahr 2028 keine weiteren Kürzungen zu erwarten sind und die niederländische Kulturlandschaft dann neu evaluiert werde. Zum Zeitpunkt dieser Äußerung gingen aber noch alle davon aus, dass Mark Rutte 2028 noch Ministerpräsident sein wird. Wie sich die Kulturförderung nach den nun anstehenden Neuwahlen unter einem anderen Ministerpräsidenten entwickeln wird, wagt zurzeit niemand vorherzusagen.
Zusammenbruch und Auferstehung in der Republik Irland
Während die Niederlande mit knapp 18 Millionen Einwohnern etwa dem deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen vergleichbar sind, hat die Republik Irland nur gute fünf Millionen Einwohner auf einer deutlich größeren Fläche, die außerhalb der wenigen Großstädte sehr ländlich geprägt ist. Im Jahr 1951 wurde das irische Arts Council (irisch: An Chomhairie Ealaíon) nach englischem Vorbild gegründet, um traditionelle und moderne irische Künste zu fördern.
Im Jahr 2023 verteilt das Arts Council etwa 130 Millionen Euro, pro Einwohner also deutlich weniger Geld als in den Niederlanden für die Künste ausgegeben wird. Allerdings darf nicht vergessen werden, dass die Finanzkrise in Irland besonders harte Folgen hatte und danach fast alle Budgets mit dem Ziel der Haushaltskonsolidierung extrem stark zusammengestrichen wurde. In den vergangenen Jahren ist das Bemühen der irischen Regierung deutlich zu spüren, die Künste stärker zu unterstützen.
Auch in Irland wird bei der Mittelverteilung großer Wert auf die Stichworte Diversität, Gleichberechtigung und faire Bezahlung der Künstler gelegt. Dem irischen Arts Council ist dabei sehr bewusst, dass diese Anstrengungen zusätzliche Mittel erforderlich machen. Anders als in den Niederlanden wurde in Irland aber tatsächlich mehr Geld zur Verfügung gestellt. So wuchsen die Mittel des Arts Council von 75 Millionen im Jahr 2019 um 55 Millionen Euro an und haben nun das Vorkrisenniveau wieder erreicht.
Das hängt auch mit der bewussten Entscheidung der Dubliner Regierung zusammen, den oft in prekären Umständen lebenden Künstlern während der Covid-Epidemie mit verhältnismäßig großzügig bemessenen Finanzmitteln zu helfen. Diese Steigerung soll nun verstetigt werden, im kommenden Haushaltsjahr wird eine Steigerung auf 150 Millionen Euro erhofft und erwartet. Nach einer Zeit des Kulturabbaus direkt nach der Finanzkrise von 2007/2008 ist in der Republik Irland nun eine deutliche Zuversicht zu spüren, dass erfolgreiche etablierte Unternehmungen weiterhin gefördert werden und neue Initiativen entwickelt werden können, um frische künstlerische Ideen auszuprobieren und ein Publikum jenseits der Großstädte Dublin, Cork, Limerick und Galway zu erreichen.
Mobilität zwischen den Grafschaften ist erwünscht, führt aber zu neuen Diskussionen, die auch andernorts virulent sind, wo viele Theatergruppen von Ort zu Ort reisen wie die deutschen Landestheater mit mehreren Spielstätten: Wer nur in seinem Ort bleibt, erreicht weniger Publikum. Wer hingegen viel reist, verschlechtert seine Klimabilanz. Eine nachhaltige Lösung erfordert wiederum mehr Geld, was zu Umschichtungen, wenn nicht Kürzungen in den Produktionsetats führt. Wie allerorten zu beobachten, führen wachsende Gesamtbudgets jedoch zu einem entspannteren Diskussionsklima.
Auch in Irland konkurrieren zahlreiche Künstler und Künstlerinnen um beschränkte Mittel der öffentlichen Hand, da diese Mittel in den vergangenen Jahren aber kontinuierlich wuchsen und daran die Wertschätzung der Künste durch die offiziellen Stellen spürbar wird, hat die Auseinandersetzung über die Bedeutung der Kunst für das Gemeinwesen an Schärfe verloren. Im Bewerbungsverfahren um die Fördermittel scheint zudem nach wie vor die künstlerische Qualität (so vage eine solche Bewertung auch immer sein mag) im Vordergrund zu stehen, nicht gesellschaftspolitische Nebeneffekte. Auch so wird die Kunstfreiheit gewahrt.
In Deutschland?
In Deutschland ist die Lage schon aus historischen Gründen viel unübersichtlicher als in den beiden zuvor behandelten, deutlich kleineren Nationen. Kulturförderung ist vor allem Ländersache und die Länder gehen damit durchaus unterschiedlich um. Das zeigte sich exemplarisch während der Corona-Pandemie, in der das Land Berlin, zumindest zu Beginn, extrem schnell und unbürokratisch Geld zu Verfügung stellte, während in anderen Bundesländern der Verwaltungsweg strikt eingehalten wurde. Mit der Dauer der Corona-Einschränkungen verfestigte sich aber auch in der Hauptstadt der Eindruck, die angeblich unbürokratischen Hilfen seien extra kompliziert gestaltet worden, um eine Auszahlung möglichst zu verhindern.
Auch in Deutschland wurde in der Krise unübersehbar, wieviele Künstlerinnen und Künstler von ihrer Arbeit kaum leben können. Von den soloselbstständigen Künstlern hatte nur eine Minderheit in den Jahren vor Corona so große Rücklagen gebildet, dass sie mehrere Monate ohne Einkommen überbrücken konnten. Selbst etablierte Künstler aller Sparten gerieten in große Schwierigkeiten, weil das öffentliche Leben, wesentlich für die Ausübung jeder Kunst, stillgelegt war.
Für eine kurze Zeit zu Beginn der Pandemie schienen sowohl Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) als auch die zuständigen Landesminister und -senatoren über die Parteigrenzen hinweg ernsthaft daran interessiert, die finanzielle Absicherung von Künstlerinnen und Künstlern neu zu ordnen. Der damalige Berliner Kultursenator Klaus Lederer von der Linken legte großen Wert auf faire Bezahlung und wollte diese in den Förderkriterien des Landes Berlin festschreiben. Wie das bei schwer messbaren Arbeitszeiten bestimmt werden soll, konnte er jedoch nicht beantworten.
Während die soloselbstständigen Leistungsträger der Kulturszene in der unfreiwilligen Betriebspause durch die Corona-Pandemie auf Verbesserungen danach hofften und über neue Modelle nachdachten, vor allem aber auf eine Mittelerhöhung hofften, erweist sich der Betrieb inzwischen als erstaunlich veränderungsresistent. Die Antragsbürokratie hat die Arbeit wiederaufgenommen und besteht auf Erfüllung eines immer länger werdenden Kriterienkatalogs. Vor allem die geforderten Honoraruntergrenzen erweisen sich dabei als Kostenfalle für jeden Kulturveranstalter, der Projektförderung annimmt.
Die Rechnung ist im Grunde simpel: Wer bei gleichbleibendem Budget seine künstlerischen Angestellten besser bezahlen soll, wird auf jeden Fall quantitativ, wahrscheinlich auch qualitativ Abstriche machen müssen. Eine Opernproduktion wird also auf Stücke mit weniger Solisten zurückgreifen, wird weniger Aufwand bei Bühnenbild und Kostümen betreiben können. Zwar werden die Beschäftigten besser bezahlt, aber es gibt weniger Beschäftigte, das kulturelle Angebot schrumpft dementsprechend.
Diese Botschaft ist immerhin auch bei den Kulturpolitikern angekommen, aber es ist ungewiss, welche Schlüsse daraus gezogen werden. Zwar gab es bereits Vereinfachungen beim Zugang zur Grundsicherung vom Jobcenter. Die können nun auch freiberufliche Künstlerinnen und Künstler beantragen, wenn sie weniger Arbeit haben als 15 Wochenstunden. Auch der Zugang zur Künstlersozialkasse soll einfacher möglich sein. Beides dient aber letztlich nur der Verschleierung der nach wie vor prekären Arbeitsbedingungen freiberuflicher Künstler.
Von der aktuellen Kulturstaatsministerin Claudia Roth ist nicht mehr viel zu hören, was eine Umgestaltung der Förderlandschaft betrifft. Auch ihr ist klar, dass letztlich nur mehr Geld hilft, wenn die deutsche Kulturlandschaft in ihrer Breite erhalten werden soll, aber sie verbreitet keinerlei Zuversicht, dieses Geld vom Haushaltsausschuss zu bekommen. Auch der Hamburger Kultursenator Carsten Brosda, während der Pandemie einer der politischen Vordenker in Sachen Neuordnung, ist inzwischen auffallend ruhig.
Unterdessen werden die politischen Stimmen der anderen Seite lauter, die wie ein Echo aus neoliberalen Hochzeiten klingen - oder wie die Kopie des niederländischen Staatssekretärs Halbe Zijlstra, der einst unter dem Druck der erstarkenden Rechtspopulisten mehr oder weniger deutlich sagte, dass Künstler, die sich nicht auf dem freien Markt finanzieren können, doch nur Schmarotzer ohne gesellschaftlichen Mehrwert seien. Unterdessen steigen inflationsbedingt und durch die Anhebung des Mindestlohns die Kosten für jedes, nicht nur für künstlerische Unternehmen weiter.
Wenn der neue Berliner Kultursenator Joe Chialo vor den Haushaltsverhandlungen auf Kürzungen in seinem Etat einstimmt, um hinterher einen bescheidenen Zuwachs als großen Erfolg zu verkaufen, ist die Richtung klar: Eine Mittelerhöhung zum Ausgleich der höheren Kosten ist unwahrscheinlich. Die Wahrung des finanziellen Status Quo gilt, ähnlich wie in den Niederlanden, bereits als Erfolg, eine Steigerung wie in Irland, wenn auch dort von einem niedrigen Ausgangsniveau, liegt in weiter Ferne.
Die tiefe Kränkung der Kunstszene, während der Pandemie als entbehrliche Unterhaltung auf der Stufe von Bordellen eingeordnet zu werden, wirkt untergründig nach und scheint viele der künstlerischen Protagonisten noch immer zu lähmen. Dabei wird es immer dringender, den gesellschaftlichen Mehrwert künstlerischen Tuns überzeugend darzustellen, um dem wirtschaftlichen Effizienzdenken der Kulturpolitiker, vor allem aber der Haushaltspolitiker entgegenzutreten.